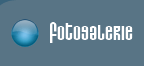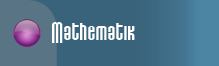Via Claudia Augusta
Zwei zufälligen Funden von Meilensteinen, 1552 in Rabland bei Meran und 1786 in einer Kirche bei Feltre, verdanken wir die Kenntnis über die Via Claudia Augusta. 1849 wurde zwar ein dritter entdeckt, der aber von einem Bildhauer zu einem Grabstein weiterverarbeitet wurde. In den Inschriften der Steine steht, dass Kaiser Claudius an jener Strecke eine Straße errichten ließ, über die sein Vater Drusus seinen Alpenfeldzug geführt hatte. Wie diese Straße genau verlief, ist leider unbekannt, vor allem weil auf den beiden Meilensteinen unterschiedliche Startpunkte genannt sind. So ist auf dem Stein von Feltre der Anfangspunkt Altinum, auf dem von Rabland hingegen der Po als Ursprung angegeben. Außerdem ist nicht genau geklärt, welchen Weg Drusus genommen hatte. Aus diesem Grund vermutet man, dass es zwei verschiedene Strecken gab, zum einen die Via Claudia Padana (ausgehend vom Po) und zudem die Via Claudia Altinate (Altinum). Erstere verlief wahrscheinlich von Hostilia, Trient, Mals, Reschen, Landeck zur Donau, zweitere ging von Altinum, Feltre, Belluno, Pieve di Cadore, Innichen ins Drautal oder über den Brenner und Seefeld zur Donau.
Verlauf
Von Altinum bis zum Reschen
Die antike Stadt Altinum spielte für das Imperium Romanum eine wichtige Rolle, da dort die Reisenden aus Aquileia eintrafen und sich hier auch ein Hafen befand, von dem es eine direkte Verbindung nach Ravenna gab. Zudem schloss hier die Via Claudia Augusta an das Straßennetz Venetiens an. Die Via Claudia führte dann über Tarvis nach Feltre, Trient, Bozen, Terlan, Vilpian, Obermais bei Meran mit Raststation, von Meran ging es weiter nach Steinach, Rabland, Naturns, Tschars, Goldrain, Schlanders, Schluderns, Glurns und Mals mit einer weiteren Raststation.
Reschen bis Landeck
Zwischen Reschen und Landeck sind die archäologischen Funde im Gegensatz zum Streckenabschnitt Altinum - Reschen eher spärlich. Man nimmt an, dass die Straße über die Malser Heide zum Reschen – Scheideck und dann weiter nach Nauders führte. Im Mittelalter gab es hier eine Übernachtungsmöglichkeit. Von Nauders aus verlief die Via Claudia Augusta nach Finstermünz (Überquerung des Inns), Schuppach, Serfaus, Fiss, Ladis, zur Pontlatzer Brücke (Überquerung des Inns) und ging dann weiter nach Landeck mit einer Raststation in Perjen.
Landeck bis Füssen
Von Landeck aus ging die Strecke weiter über Lötz, Starkenback, Mils, Galgenbühel ins Gurgltal bei Imst und verlief dann weiter über Tarrenz, Strad (Teile der Via Claudia konnten hier freigelegt werden), nach Nassereith. Hier mündete auch eine Verbindungsstraße ein, die über das Mieminger Plateau zum Brenner führte. Höchstwahrscheinlich befand sich hier ebenfalls eine Raststation. Die Via Claudia Augusta führte von Nassereith weiter über den Fernpass, Biberwier und Lermoos nach Reutte und Pflach, dann über den Kniepass nach Pinswang und Füssen.
Die Via Claudia im Mittelalter
Im frühen Mittelalter war diese römische Straße weiterhin in Verwendung, wobei jedoch die Erhaltung von Seiten der Obrigkeit wegfiel, auch wurde sie aufgrund der fehlenden Mobilität bis ins Hohe Mittelalter viel weniger benutzt. Jene Streckenabschnitte, die über gefährliche Gebiete verliefen, waren dem Verfall preisgegeben. Viele Teile blieben aber lange Zeit intakt und wurden von Reisenden, Händlern und Königen benutzt. Genaue Aufzeichnungen über diese Zeit gibt es nicht, einzig dass im 11. Jh. deutsche Kaufleute in Treviso eine Zollabgabe zu entrichten hatten. Der Transport von Waren über den Landweg war extrem teuer, es wurden vor allem Luxusartikel wie Gewürze, Seide, Wein etc., später auch Salz transportiert. Die Route über den Reschen war aber weniger frequentiert als jene über den Brenner um zu den Handelsmetropolen Venedig und Augsburg zu gelangen.
Um die Streckenabschnitte benutzten zu dürfen, mussten Zölle entrichtet werden, so zum Beispiel in Eppan, an der Töll bei Meran, in Nauders, Pfunds, an der Fernpassstraße am Fernstein, in Ernberg bei Reutte. Da die Zölle zu einer lukrativen Einnahmequelle wurden, förderten die Grafen von Tirol und Görz den Handel zunehmend. Das Zollregal verpflichtete aber auch den Belehnten damit, die Straße zu erhalten und die Sicherheit der Reisenden zu gewähren. In erster Linie waren aber die angrenzenden Gemeinden und Gerichtsverbände damit betraut, sich um die bauliche Erhaltung der Straße zu kümmern. Gleichzeitig entstand aufgrund der Notwendigkeit das Frachtsystem zu organisieren das Rodwesen. Der Begriff Rod bedeutet soviel wie „Reihe“ und regelt die einzelnen Niederlagsstätten. Als im 13. Jh. in Hall begonnen wurden Salz im großen Stil abzubauen bedurfte es einer solchen Organisation um das weiße Gold nach Norden zu bringen. Entlang der Via Claudia Augusta über den Fernpass entstanden solche Rodstätten, wie zum Beispiel in Lermoos. Die Waren wurden von Rodleuten von einem Ort zum nächsten gebracht.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()